Im Leistungssport, aber auch im Freizeit- und Fitnesssport, ist das Thema Doping ständig in der Diskussion. Vor allem Skandale im Spitzensport, aber auch Enthüllungen zum Anabolikahandel in Fitnesszentren zeigen, dass die Dimensionen und die Formen des Missbrauchs verschiedene Ausprägungen haben.
Dopingmittel und Dopingmethoden im Sport
Neben dem „einfachen“ Regelverstoß im Leistungssport existieren auch strafrechtlich relevante Formen, wie der Verkauf von Anabolika im Fitnessbereich deutlich macht. Selbst im Freizeitsport zeigt es sich, dass viele Sportler unkritisch zu Schmerzmitteln greifen, um einen Marathon besser überstehen zu können. Dass sich die Sportler dabei großen gesundheitlichen Gefahren aussetzen, wird oft ignoriert. Mithilfe der Soziologie kann das Problem nüchtern und wertfrei betrachtet werden, um Zusammenhänge zu erkennen und gesellschaftliche und individuelle Einflussgrößen zu analysieren. Dennis Sandig und Dr. Peter Dewald versuchen sich dem Problem theoretisch zu nähern, um Ihnen neue Einblicke in das Thema geben zu können.
Bestimmt auch spannend: Doping – Individueller Betrug oder Systemzwang?
Wie ist das Dopingproblem entstanden?
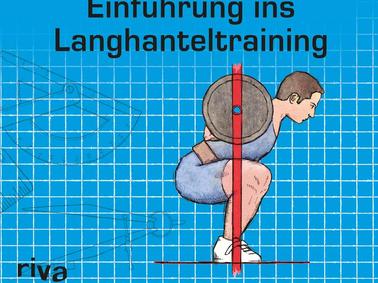
Buchtipp aus der Trainingsworldredaktion: Dieses Werk ist ein umfassender Leitfaden für den Kraftaufbau – die Grundlage für eine gute sportliche Leistungsfähigkeit und nachhaltige Gesundheit. Hier können Sie das Buch direkt im Shop oder über Amazon bestellen.
Das Doping und der Medikamentenmissbrauch sind längst kein Problem einiger weniger Leistungssportler mehr. Auch Hobbysportler greifen zu solchen Substanzen. Um allerdings Lösungsansätze gegen das Dopingproblem entwickeln zu können, ist es mitunter hilfreich, erst einmal die Strukturen im Leistungssport zu betrachten, die den Gebrauch verbotener Mittel begünstigen. Wenn wir das Dopingphänomen in seiner ganzen Komplexität des sozialen Handelns analysieren wollen, müssen wir auch das gesellschaftliche Umfeld und die Rahmenbedingungen betrachten.(1) Nur so können Voraussetzungen und Wirkungen des Dopings beschrieben und erklärt werden. Die Analyse des Dopingproblems begann mit kriminalsoziologischen Erklärungsansätzen, da es sich um eine Form der Regelverletzung handelt. Man beschreibt das Phänomen deshalb – ähnlich wie andere Verstöße gegen Normen und Regeln – allgemein als Form des „abweichenden Verhaltens“. Damit sind ein Verhalten und Verhaltensweisen gemeint, bei denen die Abweichung von anderen darin besteht, dass allgemein gültige Normen – beispielsweise in Form von Regeln im Sport – verletzt werden und dieser Regelverstoß im Rahmen sozialer Kontrolle eine Bestrafung nach sich zieht.
Im Leistungssport ergeben sich Probleme daraus, dass die Aufdeckung und die Berichterstattung zu Dopingvergehen immer als Skandal dargestellt werden. Denn das erschwert eine umfassende Aufarbeitung und Ursachenbekämpfung. Neben dem Leistungsprinzip steht der Spitzensport in unserer Gesellschaft immer noch für Prinzipien wie das der Regeltreue, der Chancengleichheit und des Fair Play. Zugleich führen die Prinzipien des Sports sowohl Sportler und Trainer als auch die Sportverbände in eine – gesellschaftlich kaum eingestandene – Situation widersprüchlicher Erwartungen. Von den Akteuren des Spitzensports wird verlangt, dass sie permanent herausragende und immer bessere Leistungen erzielen und zugleich – trotz der großen Konkurrenzintensität um Erfolg, Anerkennung und Lohn – jederzeit fair und rücksichtsvoll miteinander wettstreiten. Weder Trainer noch Sportler können jedoch die ihnen von der Öffentlichkeit abverlangten, widersprüchlichen Erwartungen dauerhaft erfüllen. (Die NADA – für fairen und sauberen Sport)
Bestimmt auch spannend: Doping im Sport – Das Gefangenendilemma
Welche Alternativen haben die Sportler und Trainer?
Unser Tipp:
Protein statt Doping
Das hochwertigste Eiklar in dreifach zertifizierte Bio-Qualität sind Good Eggwhites vom Hersteller Pumperlgsund. Da die Bio-Hennen aus Deutschland ausschließlich mit Bio-Futter versorgt werden, finden sich im Eiklar keine Rückstände von Antibiotika. Pasteurisiertes Eiklar spart Zeit, bewahrt das Eigelb vor der Mülltonne und schützt vor Salmonellen. Der Hersteller nennt das nicht nur gesund, sondern pumperlgsund. Bei Interesse könnt Ihr die Produkte direkt hier bestellen. Unsere User erhalten 15 % Rabatt auf alle Bestellungen mit dem Gutschein-Code: Fit-Mit-Trainingsworld
Wie können die Aktiven die Erwartung der Öffentlichkeit nach steter Leistungssteigerung angesichts der Tatsache, dass dem menschlichen Körper natürliche Leistungsgrenzen gesetzt sind, erfüllen? Dopingwissenschaftler folgern aus diesem Grunddilemma, dass das Dopingproblem in Sport und Gesellschaft strukturell verankert ist. So zeige sich, dass es tief in das Selbstverständnis des Sports und der Gesellschaft hineinragt. Für den einzelnen Sportler spielen Aspekte wie die finanzielle Absicherung eine Rolle. Teilweise sind die subkulturelle Verankerung des Sportlers und die daraus resultierende Rechtfertigung des Dopinggebrauchs weitere Faktoren, die zeigen, wie komplex sich das Dopingproblem gestaltet. Die negativen Folgen des Dopens für den Einzelnen stehen den kollektiven Zwängen gegenüber. Im folgenden Beitrag möchten wir das Dilemma des Sports (dass er in unserer Gesellschaft als Träger unterschiedlicher, ja konkurrierender Werte und Wünsche dient) am konkreten Fall eines einzelnen Spitzensportlers aufzeigen und so deutlich machen, welche Konsequenzen sich für die verschiedenen Akteure innerhalb des Sportsystems ergeben können.
Bestimmt auch spannend: Doping im Sport – Ausweg aus dem Gefangenendilemma
Ist der Körper eine Art biologische Maschine?
„Leistungssport“ lässt sich definieren als das „systemische Streben nach absoluter Höchstleistung.“ Dabei wird der einzelne Sportler von einem Umfeld darin unterstützt, sein Ziel des kontinuierlichen Aufbaus seines sportlichen Leistungsniveaus erreichen zu können. Der Umsetzung dieses Ziels in Deutschland dienen die Konzepte des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Spitzenverbände, denen Annahmen zur Steuerbarkeit des Sportlers und der Leistung zugrunde liegen. Dabei wird versucht, die Karrieren von Nachwuchsleistungssportlern zu lenken.
Diesen Annahmen steht der Fakt entgegen, dass Kaderkarrieren von Sportartwechseln, Verlust und Neugewinn des Status als Kadersportler, Trainingsausfall aufgrund von Verletzungen und weiteren Unwägbarkeiten geprägt sein können.(3) Die Erwartungshaltung von Trainern und Funktionären deckt sich also nicht unbedingt mit der sozialen Wirklichkeit. Da aber schon jungen Sportlern die Erfüllung bestimmter Leistungsnormen abverlangt wird, um den Kaderverbleib zu sichern, sind diese einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt.
Den in diesem Umfeld eingesetzten Rahmentrainingsplänen und Modellvorstellungen aus der Trainingslehre liegt generell die Vorstellung zugrunde, dass der menschliche Körper wie ein Computer auf eine Eingabe direkt reagiere. Dabei gehen Trainer und Sportler davon aus, dass durch das Training motorische Eigenschaften zielgerichtet entwickelt werden könnten. Ähnliche Vorstellungen finden sich z. T. auch in physiologischen Modellen, obwohl sie aufgrund der Komplexität des menschlichen Körpers und der Vielzahl sich gegenseitig beeinflussender Merkmale zu hinterfragen sind. Die zugrunde liegenden theoretischen Gesetzmäßigkeiten scheinen angesichts der biologischen Vielfalt und der Komplexität der möglichen Anpassungsreaktionen schwer begreiflich zu sein.
Wie zielgerichtet ist das Training wirklich?
Die sportliche Leistung soll „zielgerichtet“ entwickelt werden. Dabei geht man davon aus, dass die Reaktionen berechenbar sind. Die physiologische Wirklichkeit der Vielfalt von sich gegenseitig beeinflussenden Größen und Störparametern wird auf einfache Input-Output- Regeln reduziert.
Auf der anderen Seite zeigten Studien, dass Anpassungen keineswegs linear ablaufen, wie oftmals angenommen wird, sondern dass sie in zeitlichen „Lags“ (Verzögerungen) schwingen, ohne dass Vorhersagen über den Verlauf gemacht werden können. Die Adaption von Belastungen kann sich von Sportler zu Sportler, auch nach identischem Training, komplett unterscheiden. Gerade diese Unsicherheiten in Bezug auf eine Leistungsverbesserung versucht man mit Trainingsprinzipien und Modellvorstellungen zu überspielen, womit Sicherheit und Planbarkeit suggeriert werden. Hier setzt auch die medizinisch-technologische Optimierung des menschlichen Körpers an. Inwiefern ein mechanistisches Grundverständnis vom menschlichen Körper, das Interventionen zur Leistungssteigerung beinhaltet – was dann einer technischen Optimierung des Individuums gleichkäme – auch das Anwenden leistungssteigernder Maßnahmen (zu denen auch legale Nahrungsergänzung gehört) zumindest begünstigt, muss eine der zukünftigen Fragestellungen sozialwissenschaftlicher Arbeiten zum Doping werden.
Ein Fallbeispiel: Ein Sportler wird zum Doper
Anhand eines konkreten Fallbeispiels wollen wir hier die Entwicklung eines Athleten vom Nachwuchszum Spitzensportler bis zum ertappten Dopingsünder nachzeichnen. Daran sollen die Komplexität und das multifaktorielle Entstehen einer Dopingkarriere deutlich werden. Einzelne Faktoren und theoretische Erklärungsansätze schufen in diesem Fall ein Beziehungsgeflecht ungekannten Ausmaßes, dessen letzte Konsequenz der Griff zu Dopingmitteln war. Und das, obwohl dem sozialen Agenten das Verbot und auch die möglichen Strafen voll bewusst waren.
Wir sprechen hier von einem erfolgreichen Radsportler, der internationale Erfolge vorweisen kann. Bereits in der Juniorenklasse kam der 1. Kontakt mit verbotenen Substanzen zustande. Das geschah unter Obhut eines Bundestrainers, der dann im Rahmen der Aufklärung der Dopingstrukturen an der Universitätsklinik Freiburg von seinem Amt suspendiert wurde. Junge Sportler wurden also jahrelang von einem Bundestrainer betreut, der an der Empfehlung und Vergabe von leistungssteigernden Mitteln beteiligt war. Bereits in der Nachwuchsklasse kam auch unser Radsportler in Kontakt damit und wurde in ein System sozialisiert, in dem eigene Normen und Werte entstanden, die von gesamtgesellschaftlichen Verhaltenserwartungen abweichen. Er konnte also in seinem Umfeld nicht alleine entscheiden, sondern war von Trainern, Ärzten, Physiotherapeuten und Funktionären umgeben, die ihn in seinem sportlichen Erfolgsstreben unterstützten.
Gerade die Akteure des Radsports scheinen eine eigene Subkultur zu bilden, innerhalb deren sich spezifische Normen herausgebildet haben, wobei die Verwendung von Dopingpräparaten ein übliches Mittel zur Zielerreichung der Leistungssteigerung ist. Das bestätigte unser Radprofi im persönlichen Gespräch sowie in öffentlichen Interviews. Aufgrund der Legitimation des Dopings innerhalb des eigenen Umfelds entwickelt sich auch kein „schlechtes Gewissen“, da davon ausgegangen wird, dass auch andere Sportler zum Doping greifen und deshalb keine Benachteiligung anderer erkennbar ist: „Jeder macht es, jeder weiß es“, das sind Aussagen von Kronzeugen, die dies bestätigen. Die subkulturellen und gesellschaftlichen Erwartungen hinsichtlich der technologischen Optimierung und der Leistungssteigerung decken sich und drängen den Sportler zu entsprechendem Handeln. Wie gesagt: Innerhalb des persönlichen Umfelds des Radsports wird das Doping nicht als ein Vergehen angesehen. Gesellschaftlich ist die Legitimation des Dopings zwar nicht derart offensichtlich wie innerhalb der subkulturell abgegrenzten Gruppe, dennoch zeigen sich auch hier Tendenzen der Duldung und der Akzeptanz des Optimierens der Leistungsfähigkeit und des eigenen Körpers.
Ist das Doping ein gesellschaftliches Problem?
Ausgehend von den Enthüllungen im Rahmen der Festina-Affäre zeigte es sich, dass die Betrachtung des Phänomens nicht allein beim Ertappen einzelner Sportler enden darf. Wir müssen erkennen, dass nicht der in den Massenmedien oft erwähnte „Sünder“ der Kern des Übels ist! Angesichts der Schnelllebigkeit des sportlichen Erfolgs und der Notwendigkeit, Siege zu erringen, um wirtschaftlich überleben zu können, ist die Entscheidung des Sportlers, sich zu dopen, fast zwangsläufig. Da innerhalb des Radsports das Doping keineswegs als gegen die Norm verstoßend betratchtet wird, erscheint die weitere Leistungssteigerung und künstliche Verbesserung des eigenen Körpers mit allen Mitteln als gerechtfertigt, auch wenn die „Außenwelt“ die Mittel verbietet. Im Profiradsport scheint das Einnehmen verbotener Substanzen als „normal“ angesehen zu werden, wie sich anhand von Gesprächsanalysen zeigt.
Meist ist das gesamte Betreuungsumfeld involviert. Das Doping im Team Festina zeigte die organisatorische Komplexität der beteiligten Personen – vom Apotheker, über den betreuenden Arzt, vom Teamchef über die Physiotherapeuten bis hin zum einfachen Helfer: Wohnmobile wurden mit versteckten Kühlboxen ausgerüstet, schwarze Kassen geführt, die Sportler „optimiert“, wie die Verfahren im Rahmen der französischen Gerichtsbarkeit beweisen. Dennoch bleiben oft allein die als positiv getesteten Sportler im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, obwohl ein netzwerkartiges Geflecht wie das um Fuentes in Spanien und die Wiener Blutbank über ganz Europa hinweg Sportler mit verbotenen Substanzen versorgt hat.
Die Ausprägung einer Subkultur, die das Dopen nicht als einen Regelverstoß erkennt, das technologische Verständnis vom menschlichen Körper und das beständige Streben nach Leistungsverbesserung und Steigerung des Erfolgs werden jedoch auch durch das gesellschaftliche Umfeld begünstigt. Sogar beim Zuschauer lässt sich in weiten Teilen die Akzeptanz illegitimer Mittel durch im Radsport agierende Personen wahrnehmen. So entstehen gesellschaftliche Gruppierungen, die das Doping tolerieren und damit fördern.
Das Doping beginnt mit dem Umfeld
An dieser Stelle zeigt sich, wie komplex die Einflussgrößen auf den einzelnen Akteur wirken: Sozialisiert im Leistungssport werden die Betreffenden von einem Umfeld betreut, dessen kritische Haltung zum Thema Doping nicht sicher ist, da die hier Beteiligten von der Leistung ihrer Sportler abhängig sind. Das Doping stellt auch im weiteren Umfeld ein gesellschaftliches Problem dar und muss als solches in Präventionsprogrammen berücksichtigt werden. Dazu gehört beispielsweise die Tatsache, dass Medien, Zuschauer und Verbände gleichermaßen von Höchstleistungen profitieren, da diese Aufmerksamkeit, Publikumswirksamkeit und damit Sponsoren bringen. Eine kritische Berichterstattung bleibt auf einzelne Skandale bzw. die Skandalisierung des Dopings und die Konzentration auf den Sportler als den Hauptakteur des von der Norm abweichenden Verhaltens beschränkt. Zusammenhänge auf der Basis gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen werden dabei kaum hinterfragt bzw. bewusst ausgeblendet.
Das Enthüllen einzelner Dopingfälle geht einher mit dem Verhüllen sowohl struktureller Zusammenhänge als auch schon der Ursachen. Die „biografische Falle“ und die Ausweglosigkeit mancher Sportlerkarriere durch die starke Einbindung in die Fördersysteme vermindern die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten des Sportlers erheblich. Ja, er wird durch rigide Fördersysteme zu einer linear geplanten Karriere und zum Erfolg verdammt.
Vielleicht könnte ein freies und an einem ästhetischen Körperbild orientiertes Sportverständnis – fernab von dem mechanistisch-kybernetischen Bild – zu mehr Selbstbestimmung führen und so auch strukturelle Zwänge mindern. Vielleicht könnte auch eine Neuordnung des Normen- und Wertesystems des Leistungssports dazu beitragen, einen Teilkomplex der multifaktoriell angelegten Dopingstruktur zu entschärfen.
Die Prävention muss auf vielen Feldern ansetzen!
Die Grundstruktur des Leistungssports mit seinem beständigen Streben nach Rekorden und Erfolgen bildet eine Basis für die Entwicklung von Faktoren, die den Dopinggebrauch begünstigen. Auf individueller Ebene sind „biografische Fallen“ sowie das durchgängige Vermitteln kybernetischer Steuerungsannahmen ein weiterer Teilbereich, in dem das technologische Optimieren durch illegitime Mittel begünstigt wird. Auf gesellschaftlicher Ebene sind einmal subkulturelle Züge innerhalb des Sports sowie ferner Rückmeldungen der Medien, der Zuschauer und der Verbände solche Gründe, die aus Sicht des Athleten den Einsatz illegitimer Mittel rechtfertigen. Grundsätzlich ist das Doping im Leistungssport nach unserer Meinung nicht die Folge individueller Entscheidungen und Abwägungen, sondern ein Prozess, der angesichts der Grundstrukturen des Leistungssports und dessen gesellschaftlicher Einbettung fast zwangsweise geschieht. Eine Prävention muss deshalb weitgreifend und auf vielen Feldern ansetzen, um auch nur eine kleine Chance auf Erfolg zu haben!
Dennis Sandig M.A. & Dr. Peter Dewald
Quellenangaben
1. Leistungssport,1992, Bd. 22 (6), S. 55–58.
2. Leistungssport, 2008, Bd. 38 (1), Beilage S. 1–20.
Fachsprache:
Kriminalsoziologie – Richtung in der Soziologie, die sich mit dem gesellschaftlichen Erscheinungsbild von Kriminalität beschäftigt
Kybernetik – die Kunst des Regelns und Steuerns z. B. von Maschinen
Subkultur – eigene Normen und Regeln einer Untergruppe, die von denen der Allgemeinheit abweichen


